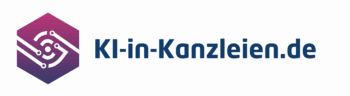Über 70 interessierte Besucher:innen kamen am 21.2. zum KI-Forum des Deutschen Anwaltvereins (DAV), um sich über den Einsatz von Künstlichen Intelligenz in der Anwaltschaft auszutauschen. Die Atmosphäre war von regem Austausch und Neugier aber auch viel Unsicherheit geprägt – das Potenzial von Künstlicher Intelligenz ist hoch, aber gleichzeitig gibt es auch viele unbeantwortete Fragen. Eine gute Gelegenheit also, beim DAV KI-Forum Antworten zu erhalten. Die Veranstaltung vereinte Expert:innen aus unterschiedlichsten Bereichen, die aktuelle Entwicklungen, regulatorische Herausforderungen und praxisnahe Einsatzmöglichkeiten von KI in der juristischen Arbeit diskutierten.

Der neue DAV-Präsident Stefan von Raumer eröffnete mit seiner Rede das Forum und betonte, dass der DAV KI zu einem Kernthema erklärt habe. Dabei stellte er klar, dass noch viel Arbeit vor der Anwaltschaft liege. Die oft zitierte Aussage, dass „KI Anwälte nicht ersetzen wird – aber jene, die keine KI nutzen, verdrängen könnte“, würde er allerdings eher mit Vorsicht betrachten.
1. Große Unsicherheiten in Brüssel zur Regulierung von KI
Kai Zenner, Büroleiter und Digitalpolitikberater des Europaabgeordneten Axel Voss, sprach in seinem Eingangsvortrag über die große Kritik am AI Act. Er merkte an, dass in Brüssel kaum noch jemand positiv über das Regelwerk spreche. Es gebe Gerüchte über Änderungen oder gar eine mögliche Rücknahme des Gesetzes, insbesondere um wirtschaftliche Nachteile für Europa wie etwa Zölle zu verhindern. In Brüssel herrsche seiner Meinung nach eine wirkliche Umbruchsphase und große Planungsunsicherheit, da noch keine klare und gemeinsame Vision existiert. Zenner hofft, dass sich in den kommenden Monaten mehr Klarheit ergibt.
2. Einige Kanzleien setzen bereits erfolgreich auf KI – aber nicht ohne Herausforderungen
Im anschließenden Panel berichteten Anwender:innen über ihre Erfahrungen mit KI im Kanzleialltag. Frederik Leenen, Head of Legal Tech bei CMS, erwartet, dass KI alle textbasierten Berufe, nachhaltig verändern wird – so auch den Anwaltsberuf. CMS testet momentan verschiedene Sprachmodelle und KI-Tools wie Noxtua. Halluzinationen, also das Erfinden von Fakten durch die KI, sind jedoch immer noch eine Herausforderung beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Neben der technischen Implementierung muss auch „Mindset-Arbeit“ geleistet werden, um alle Mitarbeiter:innen von den Vorteilen der KI zu überzeugen.
Dr. Thomas Lapp, Mediator und Rechtsanwalt bei der IT-Kanzlei dr-lapp.de, nutzt vor allem Sprachmodelle wie ChatGPT, um Schriftsätze zu entwerfen. Er setzt den Chatbot aber auch für die Mediation ein: ChatGPT kann hier sehr gut als Trainingspartner eingesetzt werden.
Innovationsberater Stefan Schicker gab zum Abschluss den Tipp, einfach mit einem GPT-Tool wie ChatGPT zu starten (das natürlich rechtskonform genutzt werden muss) und einen einfachen Use Case aufzusetzen, um Berührungsängste abzubauen.
3. Es ist nie zu spät, mit KI zu starten
Im nächsten Panel präsentierten Anbieter ihre KI-Lösungen, darunter Lawlift (Dokumentenerstellung), Prime Legal AI (Dokumentenanalyse und Wissensmanagement) sowie Bryter (Prozessautomatisierung). Schnell stellte sich die Frage: Macht es überhaupt Sinn, jetzt über KI zu sprechen, wenn so viele Kanzleien noch mit Papierakten arbeiten? Die einstimmige Antwort: Es sei nie zu spät, mit dem Einsatz von KI anzufangen. Man sollte zusätzlich nicht so stark zwischen Legal Tech, Digitalisierung und KI unterscheiden, sondern das Produkt wählen, dass die Kanzleiabläufe verbessert. Das Panel stellte die These auf, dass früher oder später ohnehin alle Kanzleien KI in Form von Sprachmodellen nutzen werden.
4. Eine bundesländerübergreifende KI-Strategie für die Justiz entsteht
Ähnlich wie in den Kanzleien gibt es auch in der Justiz noch viele Baustellen, z. B. die elektronische Akte, die die Frage aufwerfen, ob es wirklich sinnvoll ist, jetzt schon mit KI zu beginnen. Zudem gibt es in der Justiz noch viele Beschäftigte, die abgeholt und vom Einsatz der KI überzeugt werden müssen. Hier äußerte das Panel, dass man klar die Perspektive aufzeigen müsse, dass die Arbeit mit KI einfacher und besser werde.
Eine Herausforderung für die Justiz sei es, KI-Tools zu entwickeln, die für eine Vielzahl von Fällen einsetzbar seien. Niedersachsen hat z. B. mit Maki ein Tool entwickelt, das für jedes Massenverfahren eingesetzt werden kann – im Gegensatz zu den spezialisierten Tools Olga und Frauke.
Ein Problem bleibt auch der Förderalismus: So werden an verschiedenen Gerichten z. B. unterschiedliche e-Akten-Systeme eingesetzt. Dem soll durch die Entwicklung einer bundesländerübergreifende KI-Strategie entgegengewirkt werden. Diese soll auch Grundlage für Investitionsentscheidungen werden. Tendenziell gibt es auch immer mehr länderübergreifende Projekte.
5. Leitfaden der BRAK zum Einsatz von KI gibt Orientierung für Kanzleien
Ein weiterer Schwerpunkt des DAV KI-Forums lag auf den berufsrechtlichen Fragen, die sich durch den Einsatz von KI in der Anwaltschaft ergeben. Dr. Frank Remmertz stellte einen von ihm verfassten und von der BRAK veröffentlichten Leitfaden vor, der Anwält:innen Orientierung im Umgang mit KI bieten soll. Dieser wurde direkt im Anschluss von Prof. Dr. Dirk Uwer kritisch betrachtet – er stellte die Frage, ob die BRAK überhaupt die Befugnis hatte, den Leitfaden zu veröffentlichen. Die negative Einstellung des Leitfadens zum Thema KI könne man schon daran erkennen, dass dort 22-mal das Wort Risiko, aber nur einmal das Wort Chance erwähnt wird. Eine häufig gestellte Frage war weiterhin, ob Anwält:innen ihre Mandant:innen darüber informieren müssen, wenn sie KI nutzen. Hier gab es keine pauschale Antwort: Eine explizite Pflicht dazu besteht nicht, aber im Einzelfall kann Transparenz erforderlich sein.
Fazit: Die Anwaltschaft steht an einem Wendepunkt
Das KI-Forum des DAV hat deutlich gemacht, dass KI nicht nur ein Zukunftsthema ist, sondern bereits heute die juristischen Arbeitsprozesse tiefgreifend verändert. Während Großkanzleien bereits aktiv an der Umsetzung arbeiten, stehen viele kleinere Kanzleien noch vor der Herausforderung, den Einstieg zu finden. Teilweise blieb das DAV-KI-Forum in diesem Punkt auch noch zu abstrakt – anschauliche Beispiele für den Einsatz von KI-Tools wären z. B. bei den Panels der Anwender:innen und Anbieter:innen hilfreich gewesen. Auch naheliegende Themen wie KI in der juristischen Recherche oder Mandatsannahme mit KI wurden nicht aufgegriffen. Dennoch bot das DAV-Forum KI eine gute Möglichkeit, sich mit KI-Themen vertraut zu machen, zu diskutieren und tiefer in das Thema einzusteigen. Denn: Wer sich frühzeitig mit den neuen KI-Technologien vertraut macht, kann die Chancen optimal nutzen.